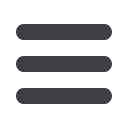
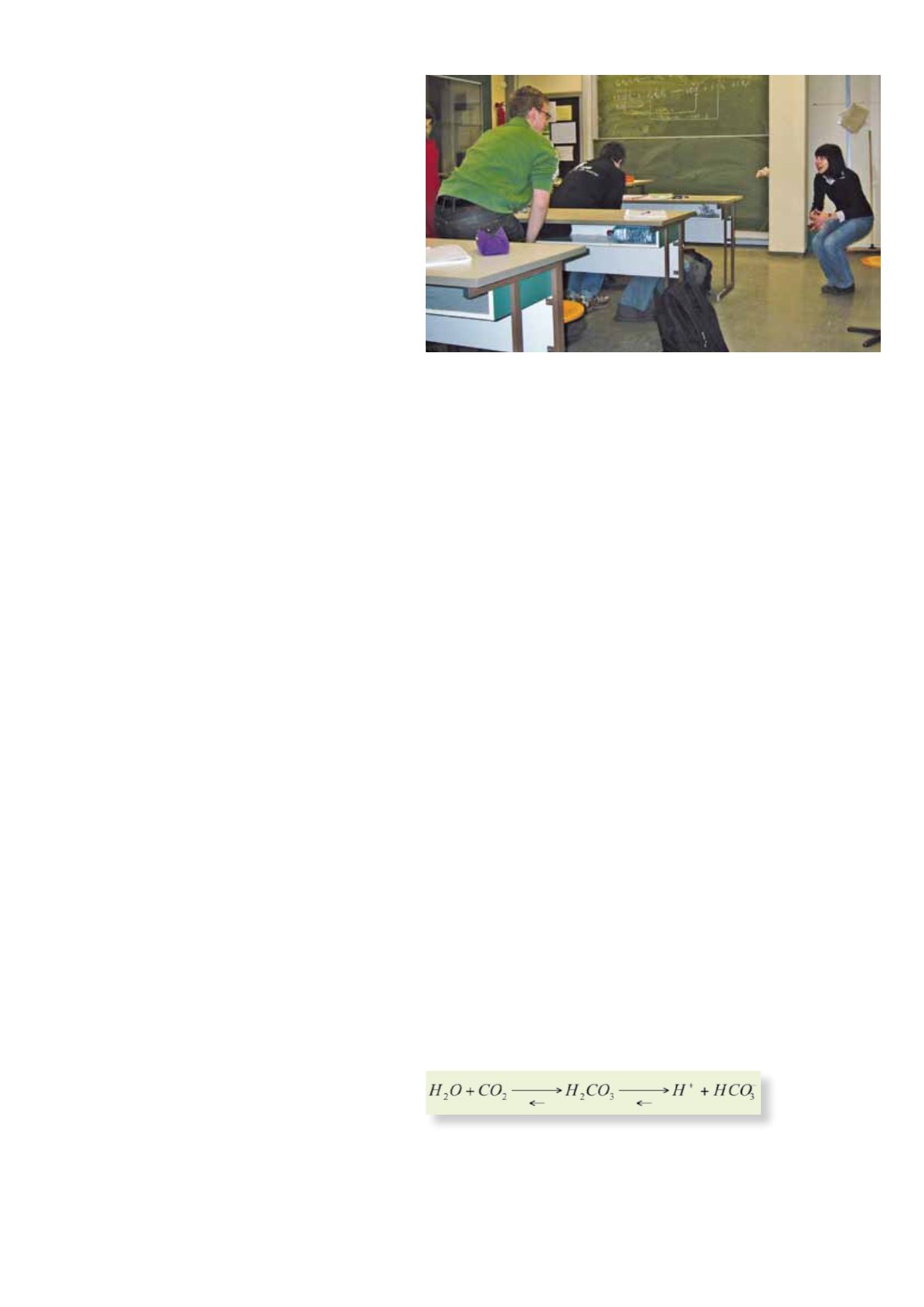
29
DENK(T)RÄUME Mobilität
Band 5: Chemie und Sport
obwohl ihnen bewusst war, dass im Körper die Ener-
giegewinnung langsamer abläuft. Außerdem erfuhren
sie, dass bei entsprechender Beanspruchung (wie z. B.
in der durchgeführten Abfahrtshocke) Milchsäure in
den Muskeln entsteht.
In der dritten Stunde stand der Sport im Vorder-
grund, denn es ging nun darum, Mittelstreckenläufe
zu trainieren.
Die hier vorgestellte Stunde bildet somit den Ab-
schluss der Unterrichtseinheit: Das verstärkte Atmen
nach einem Mittelstreckenlauf soll mit Hilfe eines
Modell-Blutpuffers unter der Einwirkung von Milch-
säure erklärt werden.
Entstehung von Milchsäure
Für die verstärkte Atmung nach einer intensiven Kurz-
zeitbelastung sind verschiedene biologisch-chemische
Faktoren verantwortlich. Im Folgenden wird dieser
Vorgang vor allem unter chemischen Gesichtspunk-
ten verkürzt betrachtet.
Bei einemMittelstreckenlauf findet über die gesamte
Belastungsdauer neben der aeroben auch die anae-
robe Energiegewinnung statt, während beim Gehen
oder beim Dauerlauf die Energie fast ausschließlich
auf aerobe Weise erzeugt wird. In den Muskelzellen
wird Glucose mit Hilfe von Sauerstoff zu Kohlen-
stoffdioxid und Wasser umgesetzt. Ohne Sauerstoff
wird das Zuckermolekül nur teilweise zerlegt, wobei
Milchsäure entsteht. Der aerobe Abbauweg ist zwar
dreizehn Mal effektiver, was die Energieausbeute an-
belangt, verläuft aber deutlich langsamer als der an-
aerobe Abbau. Daher überwiegt bei intensiven Kurz-
zeitbelastungen die anaerobe Energiebereitstellung.
Die entstandene Milchsäure geht von der Zelle in
das zirkulierende Kapillarblut und wird anschließend
mit Hilfe des Blutkreislaufsystems im ganzen Körper
verteilt. In der Leber oder in anderen Muskelzellen,
die gerade keine Arbeit verrichten müssen, wird die
Milchsäure abgebaut.
Von der Milchsäure zur verstärkten Atmung
Ein wichtiges Puffersystem immenschlichen Körper ist
der Kohlensäure-Hydrogencarbonat-Puffer des Blutes.
Dieser ist mit dafür verantwortlich, dass der pH-Wert
des Blutes nahezu konstant bleibt (pH= 7,4). Wird
Milchsäure von den Muskelzellen an das Blut abge-
geben, dann reagiert sie mit den vorhandenen Hydro-
gencarbonat-Ionen zu Lactat-Ionen und Kohlensäure.
Der Lactat-Spiegel des Blutes steigt an.
Die Kohlensäure zerfällt leicht in Wasser und Koh-
lenstoffdioxid. Ein Teil des Kohlenstoffdioxids, das
nicht durch das Enzym Carboanhydratase wieder zu
Kohlensäure umgewandelt wurde, löst sich im Blut-
plasma. Der CO
2
-Partialdruck steigt. Chemorezeptoren
nehmen diesen Anstieg wahr. Das Atemzentrum wird
zur vermehrten Tätigkeit angeregt. Auf diese Weise
kann das Kohlenstoffdioxid über die Lunge ausge-
schieden werden.
Didaktische Überlegungen
In dieser Stunde erhalten die Schüler die Möglichkeit,
ihre körperlichen Erfahrungen nach den Mittelstre-
ckenläufen chemisch zu betrachten und die erhöhte
Atemfrequenz mit Hilfe eines Modells zu begründen.
Im Zentrum der Stunde steht die Frage, warumman
nach einem Mittelstreckenlauf außer Atem ist. Die
Schüler werden hauptsächlich davon ausgehen, dass
man während des Laufens sehr viel Sauerstoff ver-
braucht und man dieses Defizit nach dem Lauf durch
die verstärkte Atmung wieder auszugleichen versucht.
Da das Thema sehr komplex ist, soll dieser Sachverhalt
mit Hilfe eines Modellversuchs zur Auswirkung der
Milchsäure auf das Kohlensäure-Hydrogencarbonat-
Puffersystem des Blutes erarbeitet werden. Eine 2,5%-
ige Natriumhydrogencarbonat-Lösung wird mit soviel
0,1 molarer Salzsäure versetzt, bis der pH-Wert der
Lösung 7,4 beträgt. Diese Lösung stellt den Kohlen-
säure-Hydrogencarbonat-Puffer im Blut da. Danach
werden 10 ml 1%-ige Milchsäure-Lösung zugesetzt,
um die Säurebildung bei der intensiven Kurzzeitbela-
stung zu simulieren. Mit Hilfe des Magnetrührers wird
kräftig durchgerührt, wobei Gasblasen aufsteigen und
der pH-Wert langsam wieder auf den ursprünglichen
Wert von 7,4 ansteigt (Atmung). Dieser Vorgang dau-
ert einige Minuten.
Die Gasblasen bestehen aus Kohlenstoffdioxid,
das sich durch den Zerfall der instabilen Kohlen-
säure bildet:
Durch das Austreiben des Kohlenstoffdioxids wird
das Gleichgewicht der rechten Reaktion nach links
verlagert (Prinzip vom kleinsten Zwang) und es wird
so lange verstärkt Kohlensäure gebildet, bis die Pro-
tonen der Milchsäure verbraucht sind.
Bildunterschrift


















