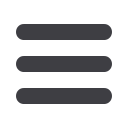

6
2.2.4 Auskultation
Auskultation (lateinisch auscultare = horchen) bedeutet Abhören des Körpers. Es werden die
spontan ablaufenden Schallerscheinungen mit bloßem Ohr oder mittels Stethoskop abgehört.
Die Beurteilung der Töne und Geräusche, vor allem wenn sie pathologisch verändert sind,
erfordert Übung und lange Erfahrung. Diagnostische Bedeutung der Auskultation:
•
Untersuchung der Lunge (Atemgeräusche, pathologische Geräusche)
•
Untersuchung des Herzens (Herztöne, Rhythmus, Geräusche, Frequenz)
•
Untersuchung des Bauches (Darmgeräusche, Peristaltik, Lebergrenzen)
•
Untersuchung der Gefäße (Verengungsgeräusche)
2.3 Leitsymptome
Unter Leitsymptomen versteht man objektive (vom Therapeuten festgestellte) oder subjektive
(vom Patienten angegebene) Krankheitszeichen, die für das Erkennen von bestimmten
rankheiten richtungsweisend sind, z. B.:
K
Organ
Leitsymptom____________________________________________________
Herz
Schmerzen, Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, Atemnot, Blaufärbung der
Lippen, Husten, Blässe, Leistungsminderung, Fieber, nächtliches Wasserlassen
Lunge
Atemnot, Auswurf, Husten, Schmerz, Fieber,
Niere:
Schmerz, Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, Blut in Urin,
Bewusstseinsstörung
Magen
Schmerzen, Gewichtsabnahme
Darm
Verstopfung, Durchfall
Leber
Gelbfärbung der Haut, Blutungen, Gerinnungsstörungen
2.4 Differentialdiagnostik
Unter Differentialdiagnostik versteht man die Zusammenstellung möglicher Krankheiten, die
von der Symptomatik her entsprechend ihrem Wahrscheinlichkeitsgrad gegeneinander
abzugrenzen sind. Die Differentialdiagnostik erfordert langjährige Erfahrungen. Es ist in der
Praxis oftmals sehr schwierig, die einzelnen in Frage kommenden Krankheitsbilder sicher
voneinander einander abzugrenzen. Oftmals sind speziellere instrumentelle Untersuchungen
erforderlich.
Die exakte Abklärung ist immer erforderlich, wenn dies therapeutische Konsequenzen hat.
Am Beispiel der Gelbfärbung der Haut (Ikterus) soll dieser Sachverhalt erläutert werden.
Klagt der Patient über starke Schmerzen (A), kann dies auf eine Kolik (Einklemmung eines
Gallensteins im Gallengang) hinweisen. Gleichzeitig kann auch noch eine Entzündung
vorliegen. Hat der Patient hingegen keine Schmerzen, aber hohe Leberwerte (B), so kann eine
ansteckende Gelbsucht vorliegen. Nach einer diagnostische Abklärung ergeben sich andere
therapeutische Konsequenzen. Bei (A) müssen möglicherweise Gallensteine operativ entfernt
werden. Bei (B) muss der Patient auf die Isolierstation gebracht werden, um die Ansteckung
anderer Menschen zu verhindern, und dort – ohne Operation – auskuriert werden.


















