
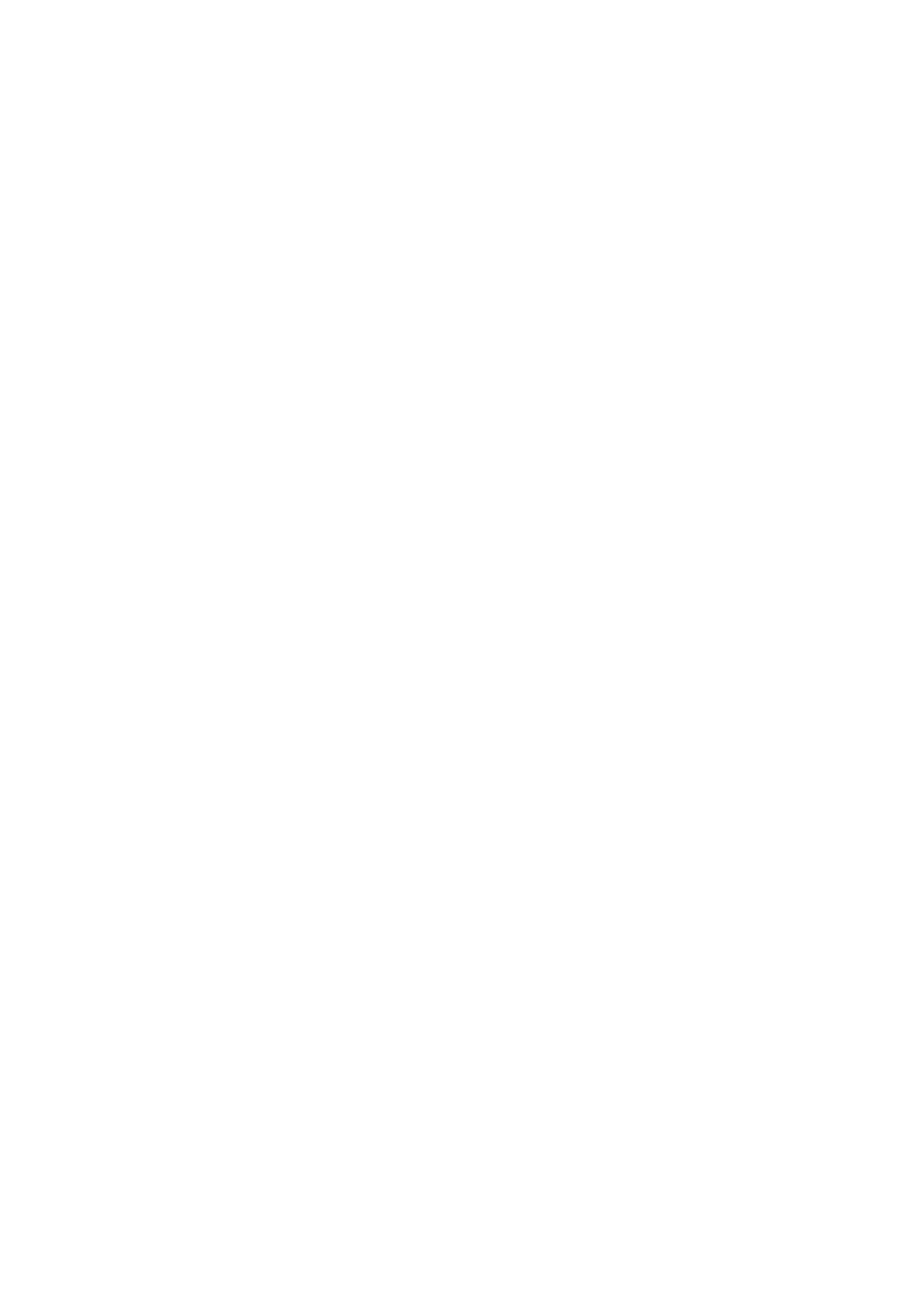
9
1 Einleitung
Das Fach Chemie gehört in der Schule zu den unbeliebtesten Fächern, nicht nur, weil
es sehr anspruchsvoll ist, sondern auch, weil die Schüler oftmals den Bezug der fachli-
chen Inhalte zu ihrem täglichen Leben nicht erkennen und weil außerdem in der Regel
viel zu wenig experimentiert wird.
Dem entgegen zu wirken, wird in letzter Zeit verstärkt und auf verschiedene Weise
versucht, mit positivem Erfolg. Das von
Ralle
et al. entwickelte Konzept „Chemie im
Kontext“ [1] ist hier als Beispiel zu nennen (s. Kasten im Kapitel 2). Unterrichtsein-
heiten wie „Chemie rund um das Auto“ [2] oder „Chemie des Meeres“ [3] stellen da-
bei spezifische Chemie-Lerninhalte in einen sinnstiftenden Zusammenhang. Das Buch
„Chemie rund um die Uhr“ [4] ist eine für Schüler sehr empfehlenswerte Lektüre,
durch die ihnen bewusst wird, dass jede Minute ihres Lebens auf irgend eine Art von
der Chemie geprägt ist, sei es beim Zähneputzen, beim Telefonieren mit dem Handy,
beim Essen und selbst beim Verliebtsein. Schließlich machen immer häufigere Bil-
dungspartnerschaften zwischen Schulen und Chemie-Firmen den jungen Menschen die
Bedeutung der Chemie in unserer Gesellschaft deutlich, und Schüler-Labore an Uni-
versitäten [5] reihen sich in die vielen lobenswerten Initiativen zur Förderung des
Chemieunterrichts nahtlos ein.
Ein weiterer Ansatz, die Bedeutung der Chemie transparenter zu machen und Interesse
für das Fach zu wecken, nutzt den Perspektivenwechsel, das heißt, in
anderen
Fächern
chemische Inhalte zu thematisieren. Im Biologieunterricht den Zitronensäure-Zyklus,
im Physikunterricht elektrochemische Phänomene oder im Erdkunde-Unterricht che-
mische Rohstoffe zu behandeln, liegt nahe. Weniger oft kommt es hingegen vor, dass
im Kunstunterricht die Maler-Palette chemisch unter die Lupe genommen wird (vgl.
[6, 7]), dass im Geschichtsunterricht betont wird, dass zeitgleich zur französischen
Revolution auch eine chemische Revolution stattgefunden hat und dass Chemiege-
schichte gleichzeitig Kulturgeschichte ist [8], dass im Deutschunterricht die Chemie-
Bezüge in
Goethes
„Wahlverwandtschaften“ vertieft werden [9, 10] oder dass im Reli-
gionsunterricht über die Berufsethik des Chemikers gesprochen und chemisch-
technischer Umweltschutz als Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung bezeichnet wird
[11-13]. Dabei zeigen die Erfahrungen, dass die Schüler gerade in den Fächern, in de-
nen sie
keine
Chemie erwarten, besonders hellhörig für chemische Informationen sind.
Deshalb spricht nichts gegen einen Unterricht, der die Fächer
Chemie und Sport
ver-
bindet. Sport spielt im Leben der Jugendlichen eine große Rolle. Also darf ein von
ihnen bevorzugtes Sportgetränk zum Objekt eines kleinen chemisch-analytischen
Praktikums oder ein aktueller Dopingfall zum Einstieg in die Steroid-Chemie genutzt
werden. Genauso sinnvoll ist es, die Schüler im Sportunterricht vergleichend einen
Sprint und einen Dauerlauf durchführen zu lassen und anschließend auf chemische
Details des anaeroben und aeroben Stoffwechsels einzugehen oder ihnen zu demonst-
rieren, dass ihr Tischtennisball brandfördernd ist.


















