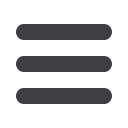

370
CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 55. Jahrgang, Heft 10/2004
Eigentlich wäre es logisch, dem Organismus den pH-
Ausgleich durch den Verzehr überwiegend basenü-
berschüssiger Nahrungsmittel (s. Tabelle S. 379) zu
erleichtern. Doch direkte Einflüsse der Nahrung auf
den pH-Wert des Blutes konnten bislang nicht nach-
gewiesen werden. Basische Lebensmittel wirken sich
bei regelmäßigem Genuss dennoch positiv auf die Puf-
ferwirkung des Blutes aus, weil sie die Pufferkapazität
erhöhen.
Eine Stabilisierung des pH-Wertes des Blutes beim
Sporttreiben ist durch die Einnahme von hydrogen-
carbonathaltigen Basenpulvern wie Sport-Basica [5]
möglich, welche die entstandene Milchsäure abge-
fangen. Dann ist auch die Regenerationsphase nach
der sportlichen Aktivität kürzer. (Basenpulver werden
auch zur allgemeinen Entsäuerung des Körpers einge-
setzt. Denn eine durch Krankheit oder fälsche Ernäh-
rung bedingte Übersäuerung ist gefährlich, weil sie
die Kapillardurchblutung vermindert und das Risiko
für einen Herzinfarkt oder Hirnschlag erhöht.)
Experimente
Löslichkeit von Harnsäure
in Abhängigkeit vom pH-Wert
Eine Spatelspitze Harnsäure wird in ein Reagenzglas
mit 2-3 ml Wasser gegeben. Es wird soviel 1 mol/l
Natronlauge zugetropft, bis der Feststoff in Lösung
gegangen ist (gelegentlich schütteln). Dann wird
überschüssige 1 mol/l Salzsäure zugetropft, wobei
die Harnsäure wieder ausfällt.
Modellversuch zur respiratorischen
Kompensation einer metabolischen Acidose [6]
2,5 g Natriumhydrogencarbonat werden in einem
250-ml-Becherglas in 100 ml Wasser gelöst. Der pH-
Wert der Lösung wird mit einem pH-Meter ermittelt.
(Von den Autoren gemessener Wert: pH = 8,2). Ein
Modell-Blutpuffer (Hydrogencarbonat/Kohlensäure)
wird hergestellt, in dem zu der magnetisch leicht ge-
rührten Lösung 18 ml 0,1 mol/l Salzsäure und danach
tropfenweise weitere Säure gegeben werden, bis der
pH-Wert 7,4 beträgt. Zur Modellierung einer meta-
bolischen Acidose werden dieser Pufferlösung 10 ml
1%ige Milchsäure zugesetzt, und der pH-Wert der Re-
aktionsmischung wird gemessen. (Von den Autoren
gefundener Wert: pH = 7,2) Zu Modellierung der
respiratorischen Kompensation der Acidose wird 1-2
Minuten kräftig gerührt, wobei Gasblasen (CO
2
) aus-
getrieben werden. Danach wird der pH-Wert erneut
gemessen. (Von den Autoren gemessener Wert: Nach
2,5 Minuten ist der pH-Wert auf 7,4 gestiegen. Bei
längerem Umrühren steigt er bis auf 7,6.)
Literatur
[1] Voet, D.; Voet, J. G.; Pratt, C. W.: Fundamentals of Bio-
chemistry, Wiley, New York, 1999, S. 712-719
[2] Remer, M.: Journal of american dietic association 1995,
S. 791-797
[3] wie [1], S. 362
[4] Asselborn, W.; Jäckel, M.; Risch, K. T. (Hrsg.): Chemie
heute – Sek. II, Schroedel, Hannover, 2003, S. 125-126
[5] Klopfer Nährmittel GmbH: Informationsblatt zu „Sport-
Basica“; Ismaing, 2004;
info@basica.de[6] Klimt, F.: Wasser- und Elektrolythaushalt, Säure/Basen-
Haushalt, Skript zur Vorlesung Sportmedizin II, Institut für
Sportmedizin und Motologie der Philipps-Universität Mar-
burg/Lahn, 1984
Um ATP als Energielieferant zu verstehen, sind die
Zahlenwerte für die freien Enthalpien der stufenweise
Hydrolyse des Moleküls hilfreich [3]: Die Reaktion
von Adenosintriphoshat mit Wasser zu Adenosindi-
phosphat und Phosphat liefert –30,5 kJ/mol, die von
Adenosintriphosphat mit Wasser zu Adenosinmono-
phosphat und Diphosphat –32,5 kJ/mol. Diphosphat
hydrolysiert weiter zu zwei Molekülen Phosphat, ver-
bunden mit einer freien Enthalpie von –33,5 kJ/mol. Es
können also insgesamt zwei sehr energiereiche Phos-
phorsäureanhydrid-Bindungen konsumiert werden.
Die viel weniger exergonische Hydrolyse der ortho-
glycosidischen P-O-C-Einheit im Adenosinmonophos-
phat zu Adenosin und Phosphat (ca. –9 kJ/mol) spielt
bei der Energieversorgung der Muskeln praktisch
keine Rolle. Wenn man einen Löffel des Säureanhy-
drids Phopshor(V)-oxid in ein Becherglas mit Wasser
gibt, bildet sich unter heftigem Zischen und Erwär-
men Phosphorsäure – ein geeignetes Experiment, um
Schülern ergänzend die Energie zu verdeutlichen, die
in dem P-O-P-Strukturelement steckt!


















