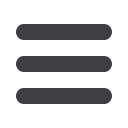

300
CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 56. Jahrgang, Heft 09/2005
und Xanthophylle in den Blättern der Pflanzen koope-
rieren, um einen großen Teil des sichtbaren Lichtes
für die Fotosynthese zugänglich zu machen. Und ist
nicht auch die Luft ein geniales Stoffgemisch? Enthielte
sie nämlich deutlich mehr Sauerstoff, würde auf Erden
vieles verbrennen. Umgekehrt, bei einem zu geringen
Sauerstoffgehalt, würden zahlreiche Lebewesen ersti-
cken. Ähnlich verhält es sich mit dem Kohlenstoffdioxid
in der Luft. Wäre da weniger, gäbe es die Fotosynthese
nicht. Und bei zuviel des Gases würde der Treibhaus-
effekt noch verheerendere Folgen nach sich ziehen.
Wenn den Schülern derartige Feinordnungen in der
Natur bewusst werden, bleibt vielleicht ein Gefühl der
Ehrfurcht vor ihr. Verdeutlichen lässt sich dies sehr
anschaulich, indem beispielsweise Verbrennungen
– etwa von Glucose – in reinem Sauerstoff durchge-
führt werden: Ist die Sauerstoffzufuhr ausreichend, so
reicht eine kleiner Funke, und die organische Materie
reagiert in einer stark exothermen Umsetzung nahezu
vollständig mit dem bereitgestellten Sauerstoff zu Koh-
lendioxid und Wasser. Entsprechend lassen sich übli-
che Redoxreaktionen mit dem sehr viel ungeeigneteren
Oxidationsmittel Stickstoff kaum durchführen – hier
gelingt bestenfalls die Umsetzung mit Magnesium zu
Magnesiumnitrid. An einen Katabolismus organischer
Materie unter den Bedingungen etwa des menschli-
chen Organismus (ca. 37°C, Normaldruck) ist da nicht
zu denken.
So kann man die Überlegung „Die Mischung macht’s“
auch auf den schmalen Temperaturkorridor übertragen,
der bestehen muss, damit Lebensformen existieren kön-
nen. Verglichen mit stellaren Bedingungen von vielen
Millionen Grad Celsius leben wir auf der Erde quasi
am absoluten Nullpunkt. Dass dennoch der Mensch auf
einen Temperaturkorridor von ca. 35-40°C beschränkt
bleiben muss, um den Ablauf seiner biochemischen Pro-
zesse zu gewährleisten, unterstreicht die Sensibilität
der Naturbalance. Selbst wenn man alle bakteriellen
Lebensformen mit einbezieht, so kann das Leben, wie
wir es kennen, eine maximale Temperaturspanne von
–20°C bis +90°C tolerieren. Experimente mit Trocken-
eis oder – wenn vorhanden – flüssigem Sauerstoff und
flüssigem Stickstoff führen die surreal anmutenden
Umweltbedingungen vor Augen, die herrschen würden,
wenn wir mit minimal veränderten Temperaturbedin-
gungen „leben“ müssten.
Vom dummen Jungen und
von gescheiten Professoren
Ehrfurcht vor dem Leben kann sich bei Schülern u. a.
entwickeln, wenn sie sich der Perfektion biochemischer
Prozesse bewusst werden. Wem gelingt es besser, Fette
zu hydrolysieren oder Eiweiße in Aminosäuren zu zerle-
gen, als den körpereigenen Lipasen bzw. Proteasen. In
Anbetracht der Effektivität dieser Biokatalysatoren ver-
blassen Haber-Boschs Eisenkatalysator zur Ammoniak-
synthese oder Wilkinsons Hydrierkatalysator vor Neid.
Experimentell zeigen lässt sich der enorme energeti-
sche Aufwand bei der Luftverbrennung zur Herstellung
geringer Mengen Salpetersäure aus der Umsetzung von
Luftstickstoff mit Luftsauerstoff und anschließender
Zugabe von Wasser. Die technischen Anstrengungen
des Menschen zur Herstellung von Nitraten aus dem
reaktionsträgen elementaren Stickstoff können sich
nicht mit den biokatalytischen Meisterleistungen der
Stickstoff-fixierenden Mikroorganismen messen, die
unter „natürlichen“ Temperatur- und Druckbedingun-
gen jährlich bis zu 200 Millionen Stickstoff umsetzen,
Dreiviertel des natürlichen Stickstoffkreislaufs.
Technische Katalysatoren zu entwickeln und die in-
teressanten Strukturen von Proteinen aufzuklären sind
zwar forscherische Meisterleistungen, doch es dürfen
Wetten darauf angenommen werden, dass es keinem
Chemikern gelingen wird, Aminsäuren zu naturidenti-
schen Proteinen zu polykondensieren. Schopenhauer
brachte es auf den Punkt:
„Jeder dumme Junge kann
einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt
können keinen zusammensetzen.“
Im Anfang war das Wort
Strukturchemisch noch interessanter als die Proteine
ist die DNA, die das menschliche Genom bestimmt.
Dieses als Reihenfolge der lediglich vier verschiedenen,
an ein aus Phosphorsäure und Desoxyribose entstande-
Wertevermittlung im Chemieunterricht
Astronomen haben einen extrasolaren Planeten entdeckt, die so nahe einen
sonnenähnlichen Stern umfliegt, dass er große Mengen seiner Materie ins Weltall
abbläst. Den Jupiter-ähnlichen Gasplaneten HD 209458b zwischen Sonnenfeuer und
Weltall-Kälte, dessen Umlaufbahn nur sieben Millionen Kilometer von dem Stern
entfernt ist, visualisierte der Künstler Alfred Vidal-Madjar (Institut d‘Astrophysique
de Paris, CNRS, France). Leben wie wir es kennen gibt es nur in einem sehr engen
Temperaturbereich, sicher nicht auf solch einem Planeten (Abb.: NASA).


















