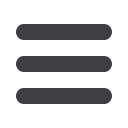
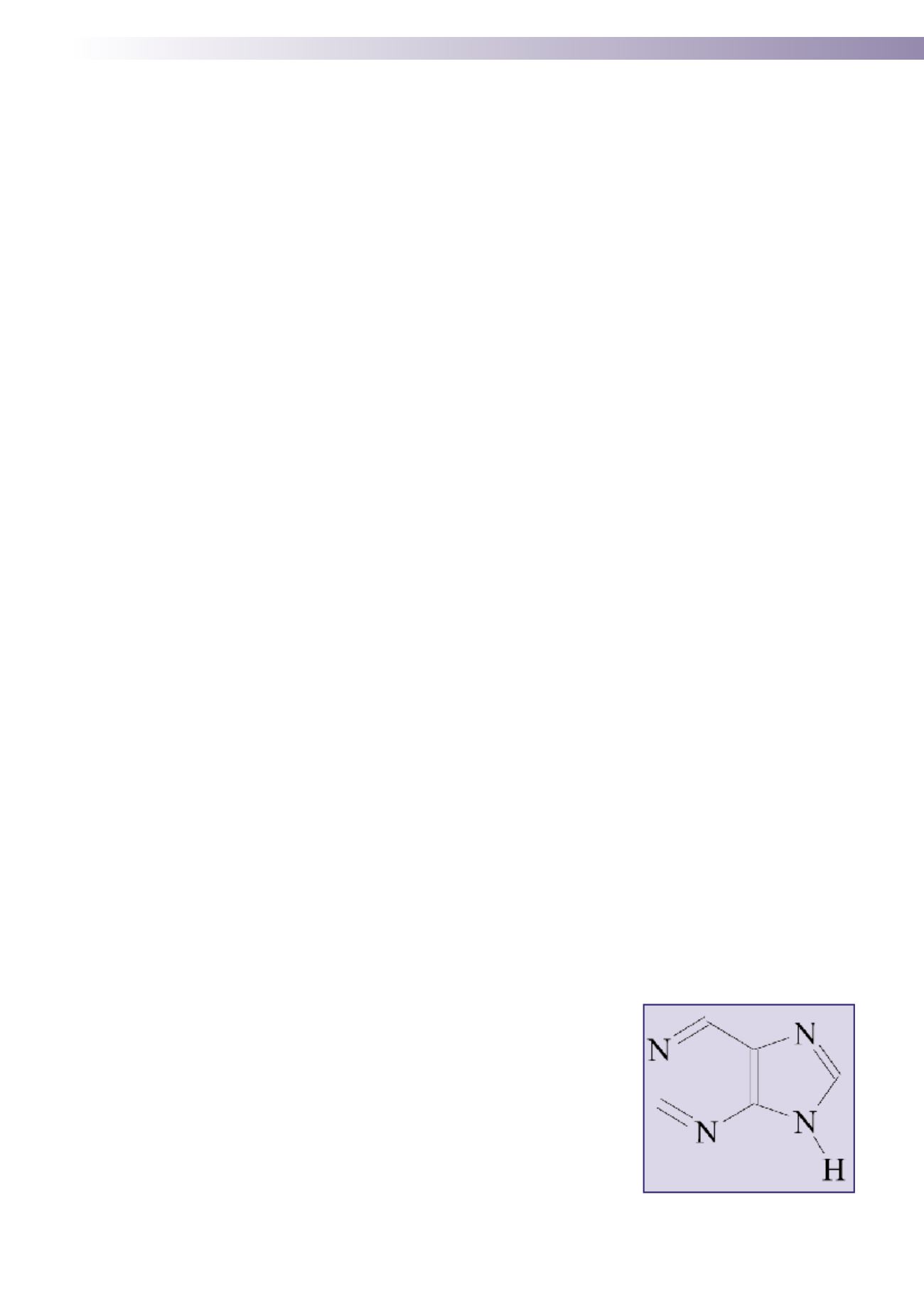
368
CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 55. Jahrgang, Heft 10/2004
Gesunde Ernährung und Energiebereitstellung im Körper
sind interessante Themen für den Oberstufenunterricht.
Im Folgenden werden zwei ausgewählte Fragen zu den
komplexen Gebiet beantwortet: Welcher gesundheitliche
Nachteil ist möglicherweise mit einem hohen Fleischkon-
sum verbunden? Wie wird bei intensivem kurzzeitigen
Sporttreiben eine Versauerung des Blutes verhindert?
Die Antworten erlauben eine Vertiefung des Themas
Säuren/Basen/Puffer im Sinne eines Spiralcurriculums.
Fleischkonsum, Nierensteine und Gicht
Fleisch ist als Eisen- und Eiweißlieferant ernährungs-
physiologisch wertvoll. Es ist aber im Vergleich zu
vielen anderen Lebensmitteln auch besonders reich
an Purinderivaten (Abbildung 1), die vor allem als
Ribo- und Desoxiribonukleotide oder Adenosinphos-
phate vorliegen.
Im menschlichen Körper werden die über die Nah-
rung aufgenommenen Purine überwiegend zu Harn-
säure verstoffwechselt. Unter Beteiligung mehrerer
Enzyme wird beispielsweise Adenosinmonophosphat
zuerst zu Inosinmonophosphat hydrolysiert, von wel-
chem dann nacheinander Phosphat und Zucker abge-
spalten werden. An das resultierende Hypoxanthin
wird Wasser addiert und das dabei gebildete Xanthin
abschließend zur Harnsäure oxidiert (Abbildung 2)
[1].
Aufgrund der Harnsäure-Bildung beim Stoffwechsel
zählt Fleisch zu den säureüberschüssigen Lebensmit-
teln (Tabelle ). Die Harnsäure wird über den Urin aus-
geschieden. Sie ist allerdings nur mäßig wasserlöslich,
so dass eine Kristallisation einsetzen kann, vor allem,
wenn die Körperflüssigkeiten krankheits- oder ernäh-
rungsbedingt zu sauer sind. In der Niere können sich
dann „Steine“ bilden. Besonders schmerzhaft ist die
Ablagerung von Harnsäure in den Gelenken (Gicht).
Früher hat man Gicht auch als „die Krankheit der Rei-
chen“ bezeichnet, weil sie das Geld hatten, sich mit
einer großen Mengen an Fleisch zu ernähren. Eine
fleischarme und basenüberschüssige Ernährung kann
derartigen gesundheitlichen Problemen vorbeugen.
In einem Versuch können Schüler das Lösungsver-
halten von Harnsäure bei verschiedenen pH-Werten
vergleichen: Im alkalischen Medium (Natronlauge) ist
der Stoff unter Salzbildung (dissoziiertes Anion und
Kation) gut löslich; bei anschließender Zugabe über-
schüssiger Salzsäure wird das Ureat protoniert, und
die schlecht wasserlösliche Harnsäure (kovalente Ver-
bindung) fällt aus. (Der Versuch ähnelt sehr dem Ex-
periment „Lösen von Benzoesäure in Natronlauge zu
Natriumbenzoat/Fällen von Benzoesäure durch Ansäu-
ern der Benzoatlösung mit Salzsäure“, der zum Grund-
curriculum des Oberstufenunterrichts gehört.)
Respiratorische Kompensation
einer Milchsäure-Acidose
Aus dem Sportunterricht kennen die Schüler den Un-
terschied zwischen der aeroben Energiebereitstellung,
z. B. bei einem Langstreckenlauf, und der anaeroben
Säuren/Basen/Puffer
Biochemie der Harnsäure und Milchsäure
Prof. Dr. Helmut Gebelein, Martin Holfeld und Prof. Dr. Volker Wiskamp, Universität Gießen,
Kaufmännische Schule Dillenburg und Fachhochschule Darmstadt
Abbildung 1:
Grundgerüst der
Purine
Die Autoren
Dr. Helmut Gebelein, Professor für Chemiedidaktik an
der Universität Gießen, Heinrich-Buff-Ring 58, 35392
Gießen; Dr. Volker Wiskamp, Professor für Chemie
an der Fachhochschule Darmstadt, Hochschulstraße
2, 64289 Darmstadt; Martin Holfeld, Chemie- und
Sportlehrer an den Kaufmännischen Schulen des Lahn-
Dill-Kreises, Uferstraße 22, 35683 Dillenburg


















