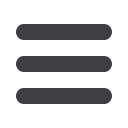

298
CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 56. Jahrgang, Heft 09/2005
Die Vermittlung von Werten erfolgt in der Schule haupt-
sächlich im Religions-, Ethik- und Philosophieunterricht.
Doch auch im Fach Chemie lassen sich Denkanstöße
entwickeln, die Wertefragen aufwerfen und Wertebewusst-
sein bei den Schülern erzeugen können. Dafür zeigt dieser
Artikel einige Beispiele (vgl. [1-3]).
Faszination der Zuverlässigkeit
Man stelle ein Glas über eine brennende Kerze, und
das Licht geht bald aus. Schon ganz junge Menschen
können das Experiment durchführen, immer wieder mit
dem gleichen Erfolg. Verblüffend ist die Zuverlässigkeit
des naturwissenschaftlichen Phänomens. Ist Zuverläs-
sigkeit nicht auch im menschlichen Leben erstrebens-
wert?
Diese sehr selbstverständliche Grunderfahrung be-
züglich der Zuverlässigkeit der Naturgesetze lässt sich
auch älteren Schülerinnen und Schülern in einem für
sie nicht naheliegenden Experiment vermitteln; ent-
sprechend den Forderungen des hessischen Lehrplans
für den Chemieunterricht an Gymnasien soll in Jahr-
gangsstufe 9 das „Gesetz der konstanten Proportionen“
vermittelt werden. Lässt man identische Mengen Blei
oder Kupfer mit jeweils variierenden Mengen Schwe-
fel vollständig zur Reaktion kommen, so werden die
Jugendlichen verblüfft feststellen, dass unabhängig von
den eingesetzten Massen jeweils konstante, „verlässli-
che“ Verhältnisse im Endprodukt auftreten. Gäbe es
dieses Gesetz nicht, und würde sich die Zusammen-
setzung von Verbindungen nach den eingesetzten
Massen richten, so wäre die Welt um uns herum nicht
beschreibbar und Leben könnte nicht existieren.
Einzigartigkeit
Jedes Salz kristallisiert in seiner charakteristischen
Kristallform, die durch eine Elementarzelle beschrie-
ben werden kann. Trotzdem gleicht kein Pyritkristall
dem anderen, kein Bergkristall seinem Nachbarn. Jedes
Mineral und Gestein ist einzigartig, ein Unikat, geschaf-
fen von dem Künstler Natur. Eine Mineraliensammlung
finden die meisten Schüler einfach schön. Und sie stau-
nen noch mehr, wenn ihnen bewusst wird, dass jedes
Material eine besondere Begabung hat. Aus Kalkstein
beispielsweise wird beim Erhitzen Kohlenstoffdioxid
ausgetrieben und gebrannter Kalk für die Bauindustrie
bleibt zurück. Aus Naturgips kann man das Kristallwas-
ser thermisch austreiben und erhält ein Material, das
z. B. für einen Gipsverband nützlich sein kann. Aus
Borax lässt sich Glas schmelzen, und Schwefel kann
über seine rasch abgekühlte Schmelze Gummieigen-
schaft erlangen. Wie ist es dazu im Vergleich mit uns
Menschen? Ist nicht auch jeder von uns ein einzigar-
tiges Geschöpft mit unverwechselbaren Eigenschaften
und Fähigkeiten, berufen zu etwas Besonderem? Das
Staunen über so viel Einzigartigkeit kann zu religiösen
Lebenseinstellungen ermutigen.
Misstraue dem Ähnlichen!
Amylose und Cellulose sind Polykondensate der Glucose
mit der empirischen Formel [C
6
H
10
O
5
]
n
und verbrennen
exotherm zu Kohlenstoffdioxid und Wasser. Die beiden
Makromoleküle sind also ähnlich – und doch einzigartig.
Denn ein „kleiner“ strukturchemischer Unterschied in
den Molekülen, die
α
-glykosidische Verknüpfung der
Bausteine in der Amylose bzw. die
β
-glykosidische Ver-
knüpfung in der isomeren Cellulose, hat enorme Kon-
sequenzen: Die Amylose ist wasserlöslich und für uns
Menschen ein wichtiges Nahrungsmittel, welches mit
Vermittlung von Wertebewusstsein im Chemieunterricht
Mutig wissenschaftliche Ergebnisse auch
gegen falsche Behauptungen benennen
Hans-Ludwig Krauß und Volker Wiskamp, Universität Gießen und Fachhochschule Darmstadt
Die Autoren
Prof. Dr. Volker Wiskamp
studierte Chemie an der Universität
Bochum, dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mül-
heim-Ruhr sowie an der Universität Berkeley. Danach war er vier
Jahre lang Polymerforscher bei Bayer. Seit 1989 vertritt er an der
Fachhochschule Darmstadt die „Anorganische und Organische
Chemie“ in der Lehre. Sein wissenschaftliches Arbeitsgebiet ist
die Didaktik der Chemie mit den Schwerpunkten Hochbegabten-
förderung, Bildungspartnerschaften Schule/Hochschule/Industrie,
fächerübergreifender Unterricht sowie Experimentieren in Kin-
dergärten und Grundschulen.
Hans-Ludwig Krauss
studierte an der Universität Gießen Che-
mie, Sport und Religion für das Lehramt am Gymnasium in der
Sekundarstufe II. Nach dem zweiten Staatsexamen war er drei
Jahre als Lehrer am Christian-Wirth-Gymnasium in Usingen und
als Ausbildungsbeauftragter für erziehungs- und gesellschaftswis-
senschaftliche Fragen in der Referendarausbildung am Studiense-
minar Frankfurt III tätig. Seit 2003 ist Krauß wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Chemie der Universität
Gießen. Dort arbeitet er an seiner Dissertation, aus der die vorlie-
gende Publikation hervor geht.
Wiskamp


















