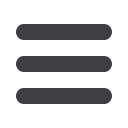

CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 55. Jahrgang, Heft 10/2004
369
AUFSÄTZE
Energiebereitstellung, z. B. bei einem 100-Meter-
Sprint.
• Aerober Glucosestoffwechsel:
•Anaerobe Glykolyse:
Der anaerobe Weg, – ausgehend vom wichtigsten En-
ergielieferanten Glukose –, ist schnell, liefert aber nur
zwei Adenosintriphosphat pro Monosaccharid. Der
aerobe Weg ist viel langsamer, allerdings in Hinblick
auf die ATP-Ausbeute 19mal wirkungsvoller als der
anaerobe.
Bei Schnellsportarten muss die ATP-Bereitstellung
rasch geschehen, und der ATP-Nachschub erfolgt des-
halb fast ausschließlich anaerob (siehe Kasten s. 370).
Die gebildete Milchsäure bewirkt eine pH-Wert-Sen-
kung des Blutes, bei starker körperlicher Anstrengung
sogar bis unter 6,9 (metabolische Acidose). (Der Soll-
pH-Wert des Blutes wird meist mit 7,4 angegeben;
Schwankungen zwischen 7,38 und 7,42 gelten als
unbedenklich.) Damit eine pH-Änderung nicht le-
bensbedrohlich wird, enthält das Blut Puffer, u. a. das
System Kohlensäure/Hydrogencarbonat (Abbildung 3),
das den Schüler aus dem Mittelstufenunterricht be-
kannt sein sollte (vgl. [4]).
Abbildung 3: Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer
Die Protonen der Milchsäure werden zunächst durch
die Pufferbase (Hydrogencarbonat) abgefangen. Dabei
sinkt deren Konzentration, während die der korres-
pondierenden Puffersäure (Kohlensäure) im venösen
Blut steigt. Nach der Hasselbalch-Henderson-Glei-
chung (Abbildung 3) müsste dann der pH-Wert sin-
ken. Um dies zu vermeiden, reagiert der menschliche
Körper mit einer Steigerung des Atemzeitvolumens.
Der Sprinter „bekommt kaum Luft“, so dass vermehrt
Kohlenstoffdioxid über die Lunge abtransportiert und
deshalb dem chemischen Gleichgewicht entzogen
wird, bis das ursprüngliche Verhältnis von Pufferba-
se und -säure wieder hergestellt ist (respiratorische
Kompensation).
Abbildung 2: Purin-Abbau
Nahrungsmittel
Potentielle Renale
Säurebelastung
(in mEq/100g)
Säureüberschüssig:
mageres Schweinefleisch
2,9
Walnüsse
6,8
Weißbrot
3,7
Weizenmehl
6,9
Eigelb
23,4
Quark
11,1
Basenüberschüssig:
Kartoffeln
-4,0
Sellerie
-5,2
Spinat
-14,0
Radieschen
-3,7
Blattsalate
-2,5
Apfelsinen
-2,7
Ananas
-2,7
Zitronen
-2,5
Tabelle : Säure- und basenüberschüssige Nahrungsmittel [2]
(Definition: Jedes Nahrungsmittel enthält eine bestimmte
Menge an Säure- und Basenresten, die im Körper eine
bestimmte Menge Salz bilden. Bleiben danach Säuren übrig,
spricht man von säureüberschüssiger Nahrung, bleiben
Basen übrig, so handelt es sich um basenüberschüssige
Nahrung.)


















